|
|

|
 |
Wer war Philipp Werner Sauber
1978 – aus: „Ein ganz gewöhnlicher Mordprozess? Das
politische Umfeld des Prozesses gegen Roland Otto, Karl Heinz Roth und Werner
Sauber“ von Klaus Dethloff, Armin Golzem und Heinrich Hannover (Hrsg.)
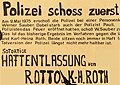 In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai wurde Philip W. Sauber auf einem Parkplatz
in Köln erschossen, Karl-Heinz Roth wurde schwer verletzt und Roland Otto
festgenommen. Wir wissen heute viel über die unmenschlichen Haftbedingungen
von Karl-Heinz, wir hören gerade nach, dass Roland Otto sitzt, aber wir
erfahren nichts über den Toten. Die Informationssperre der bürgerlichen
Presse wurde von der linken Öffentlichkeit hingenommen, ja sogar übernommen.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai wurde Philip W. Sauber auf einem Parkplatz
in Köln erschossen, Karl-Heinz Roth wurde schwer verletzt und Roland Otto
festgenommen. Wir wissen heute viel über die unmenschlichen Haftbedingungen
von Karl-Heinz, wir hören gerade nach, dass Roland Otto sitzt, aber wir
erfahren nichts über den Toten. Die Informationssperre der bürgerlichen
Presse wurde von der linken Öffentlichkeit hingenommen, ja sogar übernommen.
Es erscheint so, als ob der Kampf um das Überleben von Karl-Heinz Roth
nur mit der Verleugnung der anderen Genossen erkauft werden konnte. Warum?
Philip ist kein Opfer – und das schreckt ab, nicht nur die so genannte
liberale Öffentlichkeit, sondern auch die Linken. Philip hat sich gewehrt,
wenn wir der bürgerlichen Presse glauben sollen: mit einer Pistole soll
der Polizist Walter Pauli erschossen worden sein. Was wirklich in dieser Nacht
geschah, wissen wir nicht. Aber der Tod des Polizisten schafft das Entsetzen,
das den Tod des Genossen mit Schweigen zudeckt. Wäre Philip wehrlos erschossen
worden – wie so viele andere – wir wüssten heute mehr über
ihn, über sein Leben, über seine Geschichte.
Weil wir aus ihm kein Opfer machen können, bleiben wir sprachlos und
tun so, als hätte es ihn nie gegeben. In der Haftverschonungskampagne wurde
Karl-Heinz Roth vom Makel des politischen Untergrunds gereinigt – zu welchem
Preis? Wir haben für das Leben des Arztes und Schriftstellers unterschrieben,
den Tod und das Vergessen der Anderen haben wir dabei hingenommen. Wenn die Ereignisse
jener Nacht erwähnt werden, sehen wir nur Karl-Heinz, wir haben nicht im
Kopf, dass es auch für Roland Otto in absehbarer Zeit keine Träume
von Freiheit mehr geben wird, und dass auch der Tod von Philip eine Lücke
reißt, die schmerzt. Noch vor wenigen Jahren wäre es auch in der BRD
nicht möglich gewesen, eine Kampagne um das Leben des einen Genossen zu
führen und gleichzeitig das Totschweigen der anderen in Kauf zu nehmen.
Die Trennung in Opfer und Kämpfer ist Ausdruck von politischer Resignation
und kaum zu rechtfertigen. Die Justiz wird uns zeigen, dass sie diese Trennung
nicht macht.
Sich mit dem Kämpfer identifizieren heißt, sich mit revolutionärer
Gewalt identifizieren, denn das eine impliziert das andere. Sich mit dem Opfer
identifizieren, heißt sich mit der Gewalt der Herrschenden auseinandersetzen.
In einem Land, in dem der bewaffnete Kampf überhaupt keine Perspektive hat,
ist die Identifikation mit dem Kämpfer und seiner Tat nicht möglich.
Muss man ihn deshalb totschweigen? Die Berührungsangst versteckt sich hinter
dem Zwang zur Objektivität und der notwendigen politischen Diskussion über
die Einschätzung des gegenwärtigen Standes der Repression. Wovon niemand
spricht und wonach niemand fragt, sind die Gefühle und Erinnerungen an den
Menschen,
Das Betroffensein Einzelner und der persönliche Schmerz Weniger, die die
Schiesserei auf dem Parkplatz in Köln nicht einfach als Folge eines historischen
Irrtums vom Tisch wischen können.
Aber die Geschichte von Philip W. Sauber beginnt und endet nicht mit den
Schüssen jener Nacht. Seine Geschichte ist auch die unsere. Deshalb geht
er uns etwas an. Die Zerstörung, die die kapitalistische Gesellschaft in
uns angerichtet hat, reduziert die Geschichte der Genossen auf die Leerformel:
was hat er denn politisch so gemacht?
Hinter dieser Frage wird der Mensch nicht sichtbar, denn nicht die Formel macht
uns zum politisch handelnden Wesen, sondern die Bewältigung des Alltags,
nicht die institutionalisierte politische Arbeit bleibt in Erinnerung, sondern
das, was zufällig, wie nebenbei geschieht.
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist unser aller Geschichte politisch austauschbar:
Philip Werner Sauber, geboren 1947 in Zürich, Elternhaus Schweizer Kapitalisten,
Schule, erste Arbeiten als Fotograf und Filmemacher. Philip kann 1967 mit 20
Jahren nach Berlin. Das war kurz nach dem 2. Juni und dem Tod von Benno Ohnesorg.
Für viele war dieses Datum ein Wendepunkt der eigenen Geschichte. Philip
ging an die Filmakademie, die 1966 gegründet worden war, dort studierte
auch Holger Meins und später auch Manfred Grashof, der in Zweibrücken
einer lebenslangen Haft entgegensieht. Die ersten Jahre der Filmakademie gehören
zu den produktivsten. Die Filme, die damals entstanden, sind spontane und phantasievolle Äußerungen,
in denen Filmsprache neu, unkonventionell und provozierend benutzt wird. Holger
dreht in dieser Zeit den „Oskar Langenfeld“, Philip den „Einsamen
Wanderer“. Für beide sind es die letzten größeren Filme,
in denen sie sich als Autoren verwirklichen.
„Oskar Langenfeld“ ist ein Film über einen TB-kranken Lumpensammler
aus Berlin-Kreuzberg. Holger lebte einige Wochen mit diesem Mann und durchlief
mit ihm seine täglichen Stationen bis hin zum Männerwohnheim, wo Oskar
Langenfeld, kurz nachdem der Film fertig war, starb. Während der Arbeit
an dem Film und im Film selbst ist jene Konsequenz und Kompromisslosigkeit spürbar,
die sich durch Holgers ganzes Leben bis hin zu seinem Tod zog. Das Portrait dieses
alten Mannes ist eindringlich und genau. Er kann sich durch Sprache fast nicht
mehr verständigen. Jedes Wort wird von einem trockenen, nicht enden wollenden
Husten unterdrückt. Der Husten wird zur Sprache, in ihm erschöpft sich
die ganze Lebenskraft des alten Mannes.
Philips Film vom einsamen Wanderer ist eine Geschichte über die Austauschbarkeit
und Beliebigkeit filmischen Codes, ein Spiel mit Bildern über den Tod. Während
Holger sich ganz klar sozial engagiert und sich selbst in die Situation des Ausgestoßenen
begibt, befasst sich Philip intensiv mit Filmsprache und formal-ästhetischen
Problemen. Sein Film ist schön und lockt den Zuschauer immer wieder auf
eine Fährte vertrauter Symbole, die er aber sogleich wieder verlässt.
Auch Philip arbeitet hart und konsequent an diesem Film, konsequent innerhalb
seiner Ästhetik. Er sitzt fünf Tage und fünf Nächte am Schneidetisch.
Als der Film fertig ist, hat er ihn zugleich auch überwunden und hinter
sich gelassen. Er begreift, dass er nie wieder solche Filme machen wird. Die
Produktion von Filmen wird danach nur noch als sekundäres Moment politischer
Praxis betrachtet. Die Verbindung von politischem Anspruch und schöpferischem
Gebrauch von Filmsprache konnten zu diesem Zeitpunkt kaum geleistet werden. Die
Ablehnung der bürgerlichen Filmkunst und Ästhetik brachte nicht automatisch
eine revolutionäre Ästhetik hervor, die auch Sinnlichkeit, Lebendigkeit
und Schönheit beinhaltet hätte. Gestalterische Probleme traten zunächst
zugunsten neuer Inhalte in den Hintergrund.
Während der Notstandsgesetzgebung im Sommer 1968 wird die Filmakademie
besetzt. Damit gelingt den Filmstudenten der Anschluss an die Studentenbewegung
und den allgemeinen Streik der Berliner Hochschulen. Die Filmstudenten begreifen
die Akademie als Arbeitsplatz und fordern die Kontrolle über die Produktionsmittel.
Sie weigern sich, Zubringerdienste für die kapitalistische Bewusstseinsindustrie
zu leisten. Die Akademie hatte ganz klar die Funktion, Nachwuchs für die
Fernsehanstalten und die Filmindustrie heranzuziehen.
Jede Extravaganz eines Autorenfilmers war in diesem Rahmen erlaubt, aber die
konsequent kollektive Produktion politischer Filme stellte eine massive Bedrohung
der Interessen der Akademie dar. Die Auseinandersetzung mit dem Direktorium und
dem Senator für Wissenschaft und Kunst eskaliert sich und führt schließlich
im Herbst 1968 zur Relegation von 18 Studenten, zu ihnen gehören auch Philip
und Holger.
Das Go-in beim Direktorium ist für Philip die erste politische Auseinandersetzung,
auf die er sich auch physisch einlässt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ihn
körperliche Gewalt nur abgeschreckt. Die Möglichkeit, sich auf diesem
Weg zu wehren, musste er erst lernen. Er tat dies bewusst und unter dem Druck
der Ereignisse. Gleichzeitig bedeutete die Überwindung der Scheu vor körperlicher
Gewalt auch eine Befreiung. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde das Selbstverständnis
der Filmemacher radikal in Frage gestellt. Durch die Relegation waren die 18
Studenten von den Produktionsmitteln praktisch abgeschnitten. Als der Sender
Freies Berlin auf einem Teach-in, das in der Uni über die Relegation veranstaltet
wurde, drehen wollte, enteigneten die relegierten Studenten kurzerhand die teure
16 Millimeter Kamera.
Die Relegation beendete auch für Philip die Lebensperspektive eines
erfolgreichen Filmregisseurs. Von nun an sah er in der Kamera nur noch ein Mittel
im politischen Kampf – Filme als Anleitung zum Handeln und nicht mehr verselbständigte
künstlerische Aussage.
Philip suchte nach einer Praxis, die außerhalb der Akademie lag. In
seinem Leben gab es ein Kind, für das er jahrelang sorgte. Folgerichtig
schloss er sich der Kinderladenbewegung an, die 1968 in Berlin entstanden war.
Die Berliner Kinderladenbewegung war niemals nur eine Selbsthilfeorganisation.
Sie stand immer im Zusammenhang mit der ganzen Studentenbewegung und begriff
sich als Teil davon. Es wurde der Zentralrat der sozialistischen Kinderläden
gegründet, und regelmäßige Infos herausgegeben, in denen Kindererziehung
als revolutionäre Strategie für die Abschaffung des Kapitalismus diskutiert
wurde. Es war klar, dass der Angriff auf Kindergärten, Schule und bürgerliche
Kleinfamilie nicht zu trennen war von einem Angriff auf die gesamtgesellschaftlichen
Strukturen in der BRD.
Dieser Angriff auf den autoritären Staat umfasste alle Lebensbereiche. Das
schaffte ein neues Selbstbewusstsein und machte einen fähig, auch dort zu
handeln, wo man sich sonst, geblendet und eingeschüchtert durch fachliche
Kompetenz, abweisen ließ. Man nahm sich das Recht zu fragen und alles in
Frage zu stellen.
Als Philip eines Tages einige Kinder des Kinderladens nach Hause fahren wollte,
wurde die Autotür zugeschlagen und der Finger eines kleinen Mädchens
im Schloss eingeklemmt und von der scharfen Kante abgetrennt. Philip raste mit
dem Kind zum nahe gelegenen Westendkrankenhaus, wo die Ärzte meinten, man
müsse, um der sauberen Arbeit willen, den Rest des Fingers auch noch abtrennen.
Wir hatten damals in der Peking-Rundschau alle von den großartigen Operationen
der Chinesen gelesen und meinten, was die Chinesen können, müsste auch
hier möglich sein, und man solle den Finger wieder annähen. Die Ärzte
ließen sich auf keine Diskussion ein, da nahm Philip das Kind und raste
zu der Stelle, wo der kleine Fingerteil in einen Gully gefallen war. Er suchte
ihn zwischen dem Laub heraus, packte ihn in ein Tempotaschentuch und fuhr zu
einem anderen Krankenhaus, in dem ein Freund arbeitete. Der Finger wurde angenäht,
nach einigen Jahren war von der Narbe nichts mehr zu sehen.
Ich erwähne das nicht, um den Mythos eines Sozialhelden aufzubauen.
Es geht eher darum, aufzuzeigen, dass Handeln damals von dem Bewusstsein bestimmt
war, dass das, was notwendig ist, auch möglich sein muss.
Die politische Diskussion im Kinderladen stellte nicht nur die herrschenden
Machtstrukturen in Frage, sie führte konsequenterweise auch zu alternativen
Lebens- und Reproduktionsformen. Die meisten Genossen lebten 1967/68 noch in
Kleinfamilienzusammenhängen – so auch Philip. Aber auch für ihn
wurde der Widerspruch zwischen privater und politischer Existenz immer größer.
1969 führte sein Weg über die Kommune 2 in die ehemalige Fabriketage
der Schönberger Grunewaldstraße 88. Die Diskussion um die Organisationsfrage
im Sommer ’69 hatte viele alte Gruppen gespalten. Viele Genossen glaubten,
sich nur noch durch marxistisch-leninistische Organisationsansätze „proletarisieren“ zu
können und liquidierten ihre antiautoritäre Vergangenheit. Philip war
immer ein Gegner zentralistischer Ansätze und sah in autonomen Stadtteilgruppen
eine größere Chance, aus dem Ghetto der Studentenpolitik auszubrechen.
Die Schaffung von Gegenöffentlichkeit war für ihn dabei ein entscheidender
Punkt.
Die 18 relegierten Studenten hatten inzwischen einen Musterprozess gegen
die Akademie gewonnen. Sie wurden zwar nicht wieder aufgenommen, aber dafür
finanziell entschädigt. Einige verlebten das Geld in Berlin, andere fuhren
nach Indien, Philip kaufte sich eine Halbzoll-Video-Anlage. Die semi-professionellen
Magnet-Aufzeichnungsgeräte waren damals gerade auf den Markt gekommen und
es hatte sich schnell ein Mythos gebildet über das, was alles damit gemacht
werden konnte.
In der Fabriketage in der Grunewaldstraße 88 sollte alternatives Leben,
alternative Reproduktion und alternative Öffentlichkeitsarbeit miteinander
verbunden werden. Man wollte als politische Gruppe zusammen leben, Geld verdienen
und nach außen auftreten. Alternativ wurde nicht als rückwärts
gewandte Utopie oder Rückzug in vorkapitalistische Lebensformen verstanden,
sondern als kämpferischer gesellschaftlicher Anspruch, der fast aus einer
Position der Stärke kam.
Das Projekt in der Grunewaldstraße 88 wurde zum Teil dadurch finanziert,
dass ein anderer Genosse und Philip nachts Taxi fuhren. Im Winter 1970 war auch
Holger Meins, der im gleichen Bereich arbeiten wollte, in die Grunewaldstraße
gezogen. Es entstanden Pläne für eine Gegen-Abendschau, die in Stadtteilläden
gezeigt werden sollte. Mit der elektronischen Kamera konnte man, ohne Zeitverlust
durch die Entwicklung der Filme, aufzeichnen und wiedergeben. Es sollten besonders
lokale Belange, über die in der Abendschau offiziell berichtet wurde, aus
eigner Sicht kommentiert und ergänzt werden. Die Verbindung von mitgeschnittenen
Fernsehaufzeichnungen und Eigendarstellung des gleichen Sachverhalts schien eine
ideale Möglichkeit, die herrschende Informationspolitik durchschaubar zu
machen.
Parallel zur Filmarbeit wurde die Underground-Zeitung 883 eine Zeitlang in
der Grunewaldstraße hergestellt und von dort aus vertrieben. Diese Zeitung
wechselte ihre Herausgebergruppe oft, aber sie gehörte zu den bekanntesten
und dauerhaftesten alternativen Zeitungen, die es in der Westberliner Linken
je gab. Sie bezog immer entschiedene Position gegen die dogmatischen K-Gruppen,
verfiel allerdings ins andere Extrem, jeden aktionistischen Ansatz hochzujubeln.
Einige Zeit erschien die 883 mit dem Untertitel „Kampfblatt der kommunistischen
Rebellen“. Der Rebellentypus war die politische Kämpfergestalt, mit
der sich die Gruppe um die 883 und auch Philip am stärksten identifizierte.
In ihr waren noch all die antiautoritären Momente der Studentenbewegung
vereinigt, aber es zeichnete sich auch schon der Weg politischer Praxis ab, den
Philip einige Jahre später als den einzig für ihn gangbaren betrachtete.
Als am 4. Mai 1970 die Amerikaner in Kambodscha einmarschierten und in Kent (USA)
vier Studenten bei einer Demonstration erschossen werden, gehen in der Nacht
darauf im Amerikahaus in Berlin die Scheiben zu Bruch. Zwei Leute aus der Grunewaldstraße
und ein anderer junger Genosse werden verhaftet und bleiben ein Jahr lang in
Untersuchungshaft, danach werden sie freigesprochen. – Ein Jahr auch hebt
ein Schuster aus der Gegend eine Tasche auf, die die verhaftete Genossin zuvor
zur Reparatur gegeben hatte. Er freut sich, als er sie schließlich zurückgeben
kann. –
Von nun an wird die Grunewaldstraße 88 zur offiziellen Anlaufstelle
für die Polizei. Nach der Baader-Befreiung am 14. Mai 1970 wird zum ersten
Mal mit gezogener Pistole durchsucht. Später gehören MPs zur Standardausrüstung,
um schlafende Kinder aus den Betten zu holen. Die Verbindung von sog. „normalem
Leben“ – zum Beispiel ein Leben mit Kindern – und politischer
Praxis im Fabrikgebäude des zweiten Hinterhofs der Grunewaldstraße
88 hat bei den Bewohnern des Häuserblocks eine Sympathie geschaffen, die
auch die massiven und brutalen Polizeieinsätze, die ab Frühjahr 1970
folgten, nicht zerstören konnte. Trotz der spektakulären Aktionen der
Staatsgewalt, die die Leute aus der Fabriketage als gemeingefährliche Kriminelle
abstempeln sollten, wurde mit dem gesamten Häuserblock ein Streik gegen
den Hausbesitzer organisiert, durch den die Miete drastisch reduziert wurde.
Die Bewohner aus dem Häuserblock kamen gerne zu den Mieterversammlungen.
Für die meisten war dies die einzige Gelegenheit, aus ihrer Anderthalb-Zimmer-Wohnungs-Einsamkeit
herauszukommen. Das Zerrbild, das die Presse von den Leuten aus dem zweiten Hinterhof
zeichnete, war für sie unwichtig, denn es hatte sich Vertrauen entwickelt
durch die Kinder und durch die Offenheit, mit der ein anderes Leben nach außen
hin vertreten wurde.
Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem immer perfekter werdenden
Polizeiterror wuchs – und gleichzeitig auch das Bedürfnis sich zu
wehren und nicht ohnmächtig zu bleiben. Das Leben in einem Haus, dessen
Türen zu jeder zeit von der Polizei aufgebrochen werden konnten und auch
wurden, war immer unerträglicher geworden.
Als im August 1970 die gesamte Wohnung in der Grunewaltstraße verhaftet
wurde, waren nach der Entlassung im September für Philip und Holger die
Weichen gestellt. Für Philip war klar, dass er alles dransetzen würde,
nie wieder ins Gefängnis zu kommen. Bei Holger ging der Abbau der legalen
Existenz schnell – bei Philip dauerte es länger. Es war für ihn
schwieriger, Bindungen zu lösen, die jahrelang viel für ihn bedeutet
hatten.
Der Hass auf eine Gesellschaft, die menschliches Glück verbietet und die
Angst davor, eines Tages Opfer dieser Gesellschaft zu sein, brachte ihn schließlich
dazu, sein Bedürfnis nach Wärme und Zärtlichkeit und seine Gefühle
für die Menschen, die er liebte, einem politischen Leistungsdruck zu beugen.
Er zwang sich seine individuellen Bindungen an Menschen zugunsten einer abstrakten
Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit zu verdrängen – nur
so konnte er die Trennung schaffen.
Nach der Haftentlassung entsteht noch ein Video-Film, „reißt
die Mauern ein – holt die Menschen raus“, der erste und einzige,
der sich mit der Situation der politischen Gefangenen in der BRD und Westberlin
befasst. Die Ton-Steine-Scherben schreiben dafür ihr Gefangenenlied. Der
Film wurde auf einem Teach-in über die Black-Panther gezeigt und sollte
bewusst machen, dass es auch bei uns politische Gefangene gibt, was manche linken
Gruppen damals gern übersahen. Der Tagesspiegel registrierte den Film einen
Tag später als „Terrorfilm“.
1971 verlässt Philip die Grunewaldstraße und unterrichtet noch
einige Zeit an der Hochschule für Bildende Künste im Bereich visueller
Kommunikation.
Dann folgt der sukzessive Rückzug. Es geschieht das, was man mit so vielen
ehemals vertrauten Genossen erlebt hat: man lebt zusammen, man trennt sich, man
sieht sich noch manchmal, dann immer seltener und schließlich gar nicht
mehr. Und eines Morgens schlägt man die Zeitung auf, sieht die Fahndungsbilder
und begreift und hofft nur noch aufs Überleben.
Philip hat versucht, sich im Untergrund eine neue „legale“ Existenz
aufzubauen. Er ist in die Fabrik gegangen, das war eine politische Entscheidung,
die mit dem, was auf dem Parkplatz in Köln-Gremberg geschehen sein soll,
nicht zusammenpasst. Aber auch er hat es nicht geschafft zu überleben. Nach
der Entführung von Peter Lorenz wurden Täter gesucht – Philip
sollte einer von ihnen sein. Aber niemand kann sich erklären, wie man jemanden
in Berlin entführen kann, wenn man bei Klöckner-Humboldt – Deutz
in Köln an der Stanze steht.
Philip lebt weiter – nicht an den Wänden der Universität,
aber in der Erinnerung der Bewohner des Häuserblocks der Grunewaldstraße
88, die sich nicht abschrecken ließen, zu einem Menschen zu halten, den
sie kannten und dem sie vertrauten. |
 |
|
 |
|
|